Hermann Bräuer: Haarweg zur Hölle
von rls anno 2010
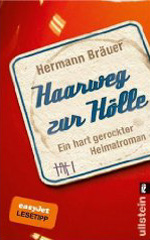
Der Weg zum Erfolg ist steinig und beinhaltet ungeahnte Stolperfallen. Das müssen auch die Protagonisten in Hermann Bräuers "hart gerocktem Heimatroman" (so der Untertitel) erkennen. Die Titulierung "Roman" ist dabei so eine Sache, denn eigentlich erzählt uns Bräuer hier so etwas wie seine eigene Lebensgeschichte: Seine Biographie weist aus, er habe in den Achtzigern in diversen Bands gespielt, die um ein Haar berühmt geworden wären, und der letzte Halbsatz ist doppelsinnig zu verstehen. Es geht im Buch nämlich um Hair Metal, also eine Kategorie der harten Gitarrenmusik der Achtziger, die sich eigentlich wie der damalige White und der damalige Black Metal weniger an musikalischen Merkmalen differenzieren ließ, und im Gegensatz zum White und Black Metal, für die man als Einsortierungskriterium die ja noch direkt zur Musik gehörenden Texte anwendete (bevor der Terminus White Metal zu verschwinden begann und der Terminus Black Metal mehr und mehr eine musikalisch definierte Bedeutung bekam), ging es beim Hair Metal rein um das Aussehen der Musiker. Rein musikstilistisch hatten etwa Europe ja nicht so viel mit Poison zu tun, aber von den Frisuren und der restlichen Optik her stopfte man beide in die Hair Metal-Schublade, obwohl in der konkreten Ausprägung der Elemente auch noch mannigfache Unterschiede festzustellen waren. Die ach so harten Metaller am anderen Ende des Spektrums waren schnell mit dem Wort "Poser" zur Stelle, obwohl sie verkannten, daß sie das in der eigentlichen Bedeutung des Wortes selber auch waren, es sei denn, sie zogen mit Schwert und Streitroß alles vernichtend durch die Straßen von Los Angeles (ein Phänomen, das man später in den ganzen Mittelalter- und Viking Metal-Bands wiederfindet, deren Mitglieder ohne ihren iPod nicht leben können und ohne die Pizzeria an der Ecke aufgeschmissen wären). Bräuer schlüsselt die Sache etwas anders auf, wie man gleich auf dem Backcover lesen kann: "Wir machen es wie Mötley Crüe oder Ratt: Wir sehen aus wie Mädchen, können uns nahezu unbemerkt an sie anpirschen und im geegneten Moment zuschlagen. Mimikry hat - Tarnung durch gefälschtes Signal." Die alte Mär der Dreifaltigkeit "Sex & Drugs & Rock'n'Roll" spielt ergo im Buch eine nicht zu verkennende Rolle - Michel Langevins Aphorismus "Why not 'Chess & books & Rock'n'Roll'?" datiert erst aus den Neunzigern.
Die Handlung spielt im München der 80er Jahre, wobei sich Bräuer einige Freiheiten im Zeitmanagement erlaubt und die Jahre etwas rafft, wie man beim Lesen anhand kleiner Indizien bemerkt. Ich-Erzähler Andreas Holzinger, ein Gymnasiast aus bürgerlichem Elternhaus, wird über die Stationen Kiss und Van Halen zum begeisterten Hardrockanhänger, geht den Weg der Härtesten allerdings nicht mit, sondern bleibt sozusagen auf der Poserseite. Als Gitarrist wenig talentiert, steigt er auf Baß um und gründet mit seinem trommelnden besten Freund, Banknachbarn und Später-Beinahe-Schwager die Band Llord Nakcor (wer es rückwärts liest, erkennt die Bedeutung). Der Ur-Sänger muß wegen eines Umzuges nach Norddeutschland aussteigen, der Ersatz entpuppt sich als äußerst fähiger Sänger, aber auch als Exzentriker, dessen Aktionen immer wieder für Ärger im Bandumfeld sorgen. Der Ur-Gitarrist, ebenfalls nur mäßig befähigt, wird hinauskomplimentiert, als sich ein Cellist an der Schule auch als hervorragender Gitarrist entpuppt. Eher als Luftikus erweist sich der Manager der Band, die sich bald in Löve Stealer umbenennt und nach etlichem Hin und Her einen Deal bei der Intercord ergattert. In der gleichen Woche wie ihr Debütalbum kommt allerdings auch Nirvanas "Nevermind" auf den Markt, verwandelt die Musiklandschaft quasi über Nacht, raubt dem Hair Metal sowohl die ganzen Mitläufer-Trendfans als auch einen Gutteil der weiblichen Anhänger und zieht damit Löve Stealer quasi den Stecker aus der Steckdose. Nach einem groß angekündigten Konzert in München, zu dem in einer 1000er-Halle exakt 63 Besucher kommen, weil am gleichen Tag nur ein Stück weiter Pearl Jam spielen, geben die Bandmitglieder auf und widmen sich bürgerlichen Berufen, nur um am ersten Todestag von Kurt Cobain eine Grungeband zu gründen, allerdings schon mit der Vorahnung, damit wieder zu spät dran zu sein ...
Was sich in der Beschreibung etwas trocken liest, entpuppt sich bei der Lektüre der 256 Seiten allerdings als Feuerwerk, welches dem bei einem Konzert von Löve Stealer kaum nachsteht. Bräuer schreibt flüssig, baut massig kleine Anekdoten und Seitenhiebe ein, denkt auch mal um die Ecke und kann sich perfekt in die Welt seiner Protagonisten hineinversetzen - eben weil es offensichtlich eine Art Tatsachenroman ist und er viel von dem Beschriebenen selber erlebt hat. Absolute Kenner können vielleicht sogar ermitteln, wie das konkrete Vorbild Löve Stealers hieß, Kenner der Münchener Szene in den 80ern werden möglicherweise einige der Protagonisten wiedererkennen oder wissen zumindest, inwieweit die beschriebene Kneipen- und Clublandschaft der Realität entspricht oder was da dichterische Freiheit ist (der Rezensent kann das nicht - er lebte in den Achtzigern als braves Schulkind auf der anderen Seite des antifaschistischen Schutzwalls). Neben all den Erfolgen, die sie bis zum Deal bringen, tappen Löve Stealer immer wieder in Fettnäpfchen oder gar Fallen - köstlich die Schilderung eines Konzertes in Salzburg, bei der sie die Technik der Vorband mitbenutzen sollen, wobei sich aber herausstellt, daß die lauter umgedrehte Kreuze in ihre Marshalls geschnitten hat, um damit einen besonders schepprigen Sound hinzubekommen, was sich mit dem Anspruch einer Hair Metal-Band, deren Gitarrist spielerisch Yngwie Malmsteen nachzueifern beginnt, nun ganz und gar nicht verträgt. Interessanterweise beginnt das Buch mit sehr detailreichen Schilderungen der Entwicklung, bevor das Erzähltempo im hinteren Drittel immer schneller zu werden beginnt - quasi ein Symbol für die Entwicklung der Band selbst. Man verschlingt allerdings auch den ersten Teil in hohem Lesetempo, wobei zum vollen Lesegenuß ein entsprechendes musikalisches Hintergrundwissen äußerst nützlich ist, um die zahllosen Witze und Anspielungen zu erkennen (es geht gleich im ersten Satz im typischen Manowar-Stil los) und bestimmte Handlungsweisen einordnen und verstehen zu können. Der adaptierte Songtitel im Haupttitel des Buches kommt übrigens im Text nur extrem selten vor ...
Hermann Bräuer: Haarweg zur Hölle. Ein hart gerockter Heimatroman. Berlin: Ullstein 2009. 256 Seiten. ISBN 978-3-548-37261-7. 7,95 Euro